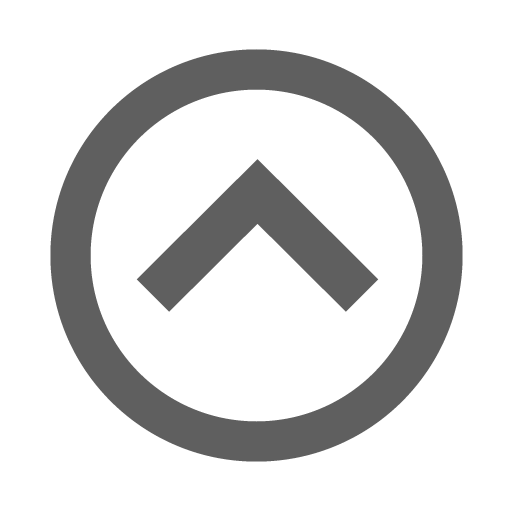Wie wirkt sich die Coronakrise auf die psychische Gesundheit aus?
Fachartikel von Robert Riedl
Seit 2020 bedroht der Coronavirus (auch Covid-19 oder SARS-CoV-2 genannt) die Gesundheit der Menschen weltweit. Staaten wie Österreich, Deutschland oder die Schweiz konnten die Corona-Epidemie durch den sogenannten Shutdown relativ schnell und gut eindämmen. Doch die dadurch entstandenen negativen Folgen auf das Wirtschaftsystem mit einem starken Anstieg der Arbeitslosenzahlen und vermehrten Insolvenzen bleiben noch lange spürbar. So entwickelte sich die sogenannte Coronakrise nicht nur in Europa zur größten gesellschaftlichen Krise seit dem Zweiten Weltkrieg; ähnlich intensiv wenn auch mit anderen sozialen Dynamiken wird sie auch zur psychischen Belastungsprobe sehr vieler Menschen auf der ganzen Welt. Und wir werden nach dem Ende der Pandemie wohl auch weiter belastet werden, da sich die Ungleichheit zwischen Arm und Reich auch in Österreich weiter verschärft.
Wie gefährlich ist der Covid-19-Erreger?
Wie der bekannte Virologe Christian Drosten feststellte, handelt es sich bei Covid-19-Infektionen "nicht um eine normale saisonale Grippe, dieser Vergleich hinkt, sondern es geht um ein pandemisches Geschehen".
Die österreichische Medizinhistorikerin Elisabeth Dietrich-Daum hält einen Vergleich der SARS-CoV-2-Pandemie etwa mit jener der Spanischen Grippe nicht für sinnvoll, da die Begleitumstände beider Pandemien vollkommen unterschiedlich seien (Anmerkung: die Spanische Grippe, die von einem besonders aggressiven Influenza Viren-Typ ausgelöst wurde, verbreitete sich bis Ende des Ersten Weltkriegs und forderte bis zu 50 Millionen Todesopfer bei einer Weltbevölkerung von 1,65 Milliarden Menschen).
Was wir bislang über Krankheitsverläufe durch Covid-19 wissen, ist, dass diese unspezifisch und vielfältig sind und stark variieren: "Neben symptomlosen Infektionen wurden überwiegend milde bis moderate Verläufe beobachtet, jedoch auch schwere mit beidseitigen Lungenentzündungen bis hin zu Lungenversagen und Tod. Neben einer Schädigung der Lunge sind auch krankhafte Prozesse der Leber, des zentralen Nervensystems, der Niere, der Blutgefäße und des Herzens beobachtet worden. Über mögliche Spätfolgen der Erkrankung an Herz, Lunge und Nervensystem besteht momentan noch Unklarheit. Diese sind Gegenstand der aktuellen Forschung" (zit. n. Wikipedia).
Zunahme von Ängsten und Angststörungen
Ein Anstieg von Ängsten ist in Krisenzeiten vollkommen normal, versucht uns diese lebenswichtige Emotion seit Menschengedenken doch vor Gefahren und Bedrohungen zu schützen. Deshalb war und ist es nur sinnvoll, sich regelmäßig über die aktuellen Fakten zu informieren, um sich z. B. optimal vor einer Corona-Ansteckung zu schützen. Dazu ist es nützlich, auf offizielle und wirklich vertrauenswürdige Informationskanäle zurückzugreifen – sofern dies in hilfreicher Weise geschieht (also nicht übertrieben lange und zu oft; es genügt völlig, sich etwa ein- bis maximal zweimal am Tag durch neue Nachrichten "upzudaten").
Doch Menschen mit einer ausgeprägteren ängstlichen Seite tendieren eher dazu, sich nicht mehr rational zu verhalten. Im Extremfall sucht man ohne jegliche Symptome eine Arztpraxis auf, weil man befürchtet oder sogar überzeugt ist, am Coronavirus erkrankt zu sein. Besonders betrifft dies Personen, die an sogenannter Hypochondrie leiden: einer ausgeprägten Angst bzw. Angststörung, die in der Überzeugung besteht, eine ernsthafte Erkrankung zu haben.
In Österreich sollten bereits vor der Corona-Pandemie etwa 1,2 Millionen Menschen an Angststörungen gelitten haben, d. h. sie erleben Ängste, die in ihrer Stärke eigentlich nicht angemessen sind (in der Psychotherapie unterscheidet man bei chronischem Angsterleben zwischen Angststörungen, Phobien, Panikstörungen, Posttraumatische Belastungsstörungen und Zwangsstörungen).
In der Zeit des "Shutdown" sollen sogar doppelt so viele Österreicher von Angststörungen betroffen gewesen sein (in Großbritannien waren es sogar viermal so viele Menschen als zuvor, bedingt durch den "Zick-Zack"-Kurz der britischen Regierung). Mit dem durch die Coronavirus-Krise bedingten Ausnahmezustand nahmen Ängste in der österreichischen Bevölkerung allgemein zu: ganz oben steht dabei die Angst um die eigene Existenz; einerseits – solange es keinen Impfstoff gibt – durch den Coronavirus schwer oder tödlich zu erkranken, könnte der Covid-19-Erreger doch wie ein "unsichtbarer Feind" in jeder Begegnung lauern (Mundschutz und Abstand-Halten machen uns dies nur noch bewusster); andererseits steigt durch die weltweite wirtschaftliche Stagnation bei Arbeitssuchenden und Arbeitslosen die Furcht, lange keinen Job finden zu werden bzw. bei Erwerbstätigen die Befürchtung, den Arbeitsplatz zu verlieren, oder bei Selbständigen die Sorge, fällige Kreditbeträge bzw. laufende Kosten nicht tilgen zu können und mit dem eigenen Betrieb in Konkurs zu geraten.
Krisenzeiten sind immer auch Umbruchzeiten und in Krisenumbrüchen bzw. in krisenhaften Gesellschafts- und Lebensübergängen von einer "alten Etappe" in eine "neue Etappe" tauchen Unsicherheiten und Zukunftssorgen auf: das Vertraute ist nicht mehr vertraut, und das Neue oder Unbekannte ist noch nicht zum Vertrauten und Gewohnten geworden. In jedem Umbruch liegt wie in jeder Krise die Gefahr zu scheitern aber auch die Chance, die äußeren und inneren Veränderungskräfte für die eigene Entwicklung zu nützen. Im besten Fall steigern psycho-soziale Wandlungsenergien sogar die eigene Vitalität und verbessern unsere Lebensqualität.
Zunahme von depressiven Erkrankungen
Wie Angst eine lebenswichtige Emotion des Menschen ist, um uns bestmöglich zu schützen, setzen sich auch Wut oder Trauer im Grunde für unser Überleben ein. Wut kann als gesunde emotionale Reaktion auf eine erlebte Grenzüberschreitung bewertet werden; Gefühle des Zorns oder des Ärgers versuchen uns unwillkürlich in ein aggressiveres Handeln zu bringen, um unsere Grenzen gegenüber anderen mehr oder weniger aggressiv klarzustellen. Gefühle von Trauer lassen uns einen erlittenen Verlust realisieren, um eine emotionelle Transformation unserer Beziehung zum Verlorenen zu ermöglichen. Oder Schuldgefühle können als inneres Bewertungssystem gesehen werden, das unbewusst zwischen "richtig" und "falsch" unterscheidet, um uns in "richtigeres" bzw. verantwortungsvolleres Handeln zu bringen.
Die Coronakrise hat durch die lange Zeit der sozialen Selbstisolation, durch den Verlust des Arbeitsplatzes, des bisherigen Lebensstandrads oder durch den direkten oder indirekten "Corona-Tod" eines geliebten Menschen für viele neben Angst auch Gefühle von Wut, Trauer oder Schuld entstehen lassen. So wurden die staatlichen Corona-Maßnahmen auch als Grenzüberschreitung im eigenen Alttag erlebt oder man erlitt Verlusterfahrungen durch die Kündigung des Jobs oder es stellten sich Selbstzweifel oder das sich-schuldzuweisende Gefühl ein, im Leben die "falschen" Entscheidungen getroffen zu haben. Andere erlebten den Tod von Angehörigen durch die Folgen einer Covid-19-Infektion, wobei es durch die gesetzlichen Vorgaben nicht möglich war, sich vom Verstorbenen wie üblich zu verabschieden bzw. angemessen zu trauern, da wichtige Verabschiedungsrituale unmöglich wurden.
Dies alles sind Faktoren, die den Anstieg von depressiven Erkrankungen in der Bevölkerung durch die Coronakrise erklärbar machen. Der Großteil der Personen, die einen Psychotherapeuten aufsuchen, leidet unter depressiven Verstimmungen. Sie fühlen sich freudlos, unmotiviert und dauerhaft erschöpft. Die WHO prognostizierte bereits "vor Corona", dass die Depression (lateinisch: "Niedergedrücktheit") in wenigen Jahren die zweithäufigste Erkrankung der Welt sein würde. In Österreich waren schon vor dem "Shutdown" im März 2020 mehr als 600.000 Menschen betroffen. Depressionen sind damit die häufigste seelische Ursache für Krankenstände.
Psychologisch gesehen setzen sich depressive Verstimmungen für unbewusste Anliegen ein: so können sie uns in ein suboptimales Schutzverhalten bringen, dass einem – wie vermeidendes Fluchtverhalten bei Angst – unwillkürlich zum Rückzug und zur Abschottung zwingt. Oder eine depressive Seite aktiviert in uns reflexartig ein neuronales Netzwerk aus Gefühlen und Gedanken, das unbewusst die in der "Coronazeit" eher ungünstige Funktion verfolgt, für mehr Autonomie bzw. stärkere Abgrenzungen im eigenen Leben zu sorgen. Eine depressive Seite, die sich im Leben ausprägt, könnte sich paradoxerweise auch für mehr Nähe und Verbundenheit einsetzen, indem sie automatisch Hilfsprogramme in unserem sozialen Umfeld aktiviert, wenn auch gleichzeitig depressive Personen andere oft hilflos zurücklassen, da man bei einer Depressionen das Bemühen von anderen sehr schwer als tatsächliche Hilfe erleben kann.
Aus eigener Erfahrung weiß man bestimmt, dass Schuldgefühle nicht immer hilfreich sind; wir mögen etwa gesunde Verantwortung für uns übernehmen, bekommen aber dennoch ein "schlechtes Gewissen" (zum Beispiel gegenüber Arbeitskollegen, nachdem man sich Krankenstand nahm, weil es einem etwa psychisch schlecht ging). Uns könnten auch Gefühle von Traurigkeit oder Selbstzweifel quälen, obwohl wir viele Gründe hätten, mit unserem Leben zufrieden zu sein. Oder wir sind nach einem Misserfolg wütend auf uns selber, obwohl uns bewusst ist, dass es angesichts eines persönlichen Fehlschlags viel hilfreicher wäre, milde sowie wohlwollend mit sich selbst umzugeben. Oft plagen uns in belastenden Situationen zusätzlich Ängste oder Zukunftssorgen, wenn wir emotionell belastet sind, was den inneren Druck und Stress zusätzlich erhöht.
Im depressiven Erleben entsteht ein sogenannter Problemfokus oder eine Problemfixierung der eigenen Aufmerksamkeit: man kann nur noch Problematisches wahrnehmen. Damit nimmt man die Welt als reine Problemwelt wahr: unsere Gedanken kreisen wortwörtlich Tag und Nacht über Probleme, für die sich im depressiven Erleben keine Lösungsideen finden lassen. Depressionen führen in ein Erleben des Gescheitert-Seins: nichts scheint zu gelingen. Dieser depressive Problemfokus rückt jeden Lösungshorizont aus unserem kognitiven Sichtfeld, was den kreativen Radius möglicher Lösungsstrategien extrem einengt und das Gefühl einer problemfixierten Hoffnungslosigkeit zusätzlich verstärkt. Der erlebte Unterschied zwischen "So-ist-es" und "So-sollte-es-in-meinem-Leben-sein" wird bei stärkeren Depressionen damit als unüberwindbar wahrgenommen. Unwillkürlich richtet sich unsere Aufmerksamkeit auf das Problematische im eigenen Leben: alles, was sich für uns in einer sogenannten "Ist-Soll"-Diskrepanz darstellt. Beim Versuch, das unerwünschte "Ist" zu verändern bzw. das ersehnte "Soll" zu erreichen oder die erlebten Probleme zu lösen, stösst man auf äußere oder innere Hindernisse oder Blockaden, die es einem verunmöglichen können, den "Soll"-Zustand herbeizuführen. Alle Lösungsversuche, Massnahmen und Schritte, mit denen man das Problem lösen möchte, scheinen zu scheitern, unrealistisch oder unmöglich zu sein.
Viele Menschen mit chronischen Depressionen kippten während des "Corona-Shutdowns" weiter in die Depression hinein und sahen keinen Ausweg mehr; andere konnten sich wiederum gut mit den Wochenkäufen ablenken. Personen mit sozialen Ängsten, die ohnehin ein Problem damit haben hinauszugehen oder Leute zu treffen, fühlten sich temporär teilweise sogar besser, weil das Hinausgehen für alle beschränkt war.
Zunahme von Stress und Stresserkrankungen
Stress bringt im Körper einen biologischen Prozess in Gang: durch Ausschüttung von sogenannten Stresshormonen (wie Adrenalin, Dopamin und Cortisol) sollen die erhöhten Ansprüche an uns bewältigbarer werden, indem unsere Muskulatur sich unwillkürlich anspannt oder unser Herzschlag schneller zu schlagen beginnt, um mehr Blut durch den Körper zu pumpen. Seit jeher sorgen diese inneren Stressprogramme dafür, dass wir auch in Notfallsituationen physische und psychische Höchstleistungen vollbringen können: etwa um zu kämpfen, zu flüchten oder uns zu verstecken. Stress ist an und für sich also nichts Schlechtes. Nicht nur Spitzensportler wissen, dass man unter Druck über sich hinauswachsen kann. Der berühmte Stress-Forscher Hans Selye (1907 – 1982), übrigens ein Österreicher, unterschied zwischen Disstress (dis: schlecht, krankmachend) und Eustress (eu: gut, schön, gesund). Disstress kann uns nicht nur die Lust am Arbeiten verderben; Stress, der negativ erlebt wird, wirkt sich auf unsere Leistungen aus und gefährdet die Gesundheit. Aber nicht alle gestressten Menschen werden krank!
Bereits vor der Coronakrise fühlten sich jedoch etwa 60 Prozent der Österreicher beruflich oder privat gestresst. Ein knappes Viertel klagte sogar, sehr häufig gestresst zu sein. Chronische Stresszustände führen zu Infektanfälligkeit, Krankheiten und Krankenständen. Jeder sechste Fehltag im Berufsleben soll stressbedingt erfolgen: Gründe sind etwa psychische Belastung, Aufregung, Anspannung oder Ängste.
Die Coronavirus-Krise hat das Gefühl, dass unsere Lebenswirklichkeit immer schneller und hektischer wird, einerseits durch Homeoffice, Homeschooling, Arbeitslosigkeit, fehlende Nähe und gleichzeitiger Kinderbetreuung zuhause (ohne rausgehen zu können oder durch Großeltern entlastet zu werden) vor allem für arbeitende bzw. erwerbstätige Mütter und Alleinerzieher erhöht. Erschwerend kommt hinzu, dass man den eigenen und oft erhöhten Anforderungen schwer gerecht werden kann. Bereits junge Menschen erleben diesen gesellschaftlichen Druck, den man sich unwillkürlich auch selbst macht: man soll erfolgreich sein, man soll dem Partner gerecht werden, man soll im Fitnesscenter seinen "Beachbody" formen, man soll seine Freizeit gut nützen, man soll, man soll, man soll. Die Erwartungen an sich selber sind heutzutage extrem hoch. Über 25 Prozent der Hochschüler geben an, ihr alltägliches Stressniveau mit üblichen Entspannungsstrategien (wie Hobbys, Bewegung oder Relaxen) nicht reduzieren zu können. Jeder Zweite soll bereits therapeutische Hilfe in Anspruch genommen haben, um mit dem persönlichen Stress-Level besser umgehen zu können.
Ulrich Beck (1944 – 2015) beschrieb in (seinem gleichnamigen Buch) Risikogesellschaft einen (dem 18. und 19. Jahrhundert) vergleichbaren Gesellschaftswandel für die europäische Bevölkerung im 20. Jahrhundert, "in dessen Verlauf die Menschen aus den Sozialformen der industriellen Gesellschaft – Klasse, Schicht, Familie, Geschlechtslagen von Männern und Frauen – freigesetzt werden, ähnlich wie sie im Laufe der Reformation aus der weltlichen Herrschaft der Kirche, in die Gesellschaft entlassen wurden." Dieser "gesellschaftliche Individualisierungsschub von bislang unerkannter Reichweite und Dynamik" habe sich vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg vollzogen, "und zwar bei weitgehend konstanten Ungleichheitsrelationen [...] Auf dem Hintergrund eines vergleichsweise hohen materiellen Lebensstandards und weit vorangetriebenen sozialen Sicherheiten wurden die Menschen in einem historischen Kontinuitätsbruch aus traditionellen Klassenbedingungen und Versorgungsbezügen der Familie herausgelöst und verstärkt auf sich selbst und ihr individuelles Arbeitsmarktschicksal mit allen Risiken, Chancen und Widersprüchen verwiesen."
Die Coronakrise, die für das private und soziale Umfeld eine Belastungsprobe darstellt, macht den gesellschaftlichen Individualisierungsschub dieser Risiken, Chancen und Widersprüchen durch das kapitalistische Globalwirtschaftssystem stärker spürbar und erhöht das Stresserleben in der Bevölkerung und damit auch die Anzahl von Menschen, die an einer Stresserkrankung zu leiden beginnen. Die Furcht vor einer Covid-19-Ansteckung oder die Erkrankung nahestehender Menschen mit möglicherweise tödlichen Folgen der Infektion lösen mentalen Stress aus. Tagelang in den eigenen vier Wänden bzw. in zu kleinen Wohneinheiten mit denselben Personen zu verbringen, war (bzw. – etwa bei Dauerarbeitslosigkeit – ist) für viele eine Überforderung; Spannungen innerhalb der Familie, die Einschränkung sozialer Kontakte, der berufliche Druck, die plötzliche Arbeitslosigkeit oder finanzielle Sorgen erhöh(t)en den persönlichen Stress-Level zusätzlich.
Typische Symptome von Stresserkrankungen sind etwa Schlafstörungen oder Rücken- oder Kopfschmerzen, verstärktes Schwitzen, kalte Hände oder kalte Füße. Wer über einen langen Zeitraum beruflich oder privat Dauerstress erlebt, läuft Gefahr, an der bekanntestes Stresserkrankung zu erkranken: dem Burnout. Bereits in jeder zweiten Firma soll es Mitarbeiter geben, die vom Arbeitsalltag überfordert sind, sich ausgebrannt und dauernd erschöpft fühlen. Aber auch fortdauernde Unterforderungen können zur Ausschüttung von Adrenalin, Dopamin und Cortisol führen und Stress verursachen. Wer in eigenen Alltag keine Erfüllung und keinen Sinn mehr findet, fühlt sich zumeinst unterfordert und reagiert mit Energieverlust, Mutlosigkeit und Resignation. Signale des sogenannten Boreout sind – ganz ähnlich wie beim Burnout – depressive Verstimmtheit, Müdigkeit und Antriebslosigkeit.
Zunahme des Suchtverhaltens
Österreichische Suchtberatungsstellen verzeichneten bereits während des "Shutdown" einen Zuwachs von etwa zehn Prozent an neuen Klienten, obwohl aufgrund der "Covid-19"-Epidemie die ambulante Betreuung auf telefonische Beratung umgestellt werden musste. Nach der teilweisen Wiederöffnung ab Mai 2020 zeigte sich sogar ein signifikanter Zuwachsraten auf der Warteliste für Suchtherapieplätze von ca. zwölf Prozent an neuen Hilfesuchenden.
Erklären lässt sich dieser Anstieg vor allem damit, dass Suchtverhalten häufig eine Reaktion auf psychische Belastungen darstellt. Bereits nach der Finanzkrise im Jahr 2008 konnten ähnliche Auswirkungen beobachtet werden. Zudem belegen Studien, dass bei hoher Arbeitslosigkeit eine Vielzahl psychischer Erkrankungen – darunter auch Süchte – begünstigt werden. Vermutlich wird der tatsächliche Anstieg aller Suchterkrankungen erst in zwei bis drei Jahren zu verzeichnen sein, wenn die Langzeitfolgen der "SARS-CoV-2"-Krise in vollem Umfang ersichtlich werden.
Durch die Corona-Maßnahmen ist auch eine Zunahme der Computerspielsucht wahrzunehmen. So wurden wir durch die Ausgangs- und Sozialkontaktbeschränkungen zur beruflichen oder schulischen sowie privaten Nutzung des Computers geradezu gezwungen. Viele konnten mit den Wegfall der gewohnten Alltagsstrukturen schlecht umgehen und das Nützen von elektronischen Geräten nicht mehr regulieren. So kippten vor allem Kinder und Jugendliche, die täglich einige Stunden Computer spielten, in ein übermäßiges bzw. zwanghaftes Online- und Offline-Computerspiel-Verhalten. Ähnlich der Spiel- oder Kaufsucht stellt die Computerspielsucht eine Verhaltenssucht dar, die den Alltag der Betroffenen mehr und mehr beeinflusst. Mittel- bzw. langfristig wirkt sich jede Sucht auf die physische Gesundheit aus, da die Kontrolle über das eigene Spielverhalten verloren geht und andere Interessen in den Hintergrund gedrängt werden, weil man etwa dem sogenannten Zocken zunehmend Vorrang vor anderen Aktivitäten und Lebensinhalten gibt. Charakteristisch ist auch, dass Computerspielsüchtige ihr Verhalten trotz negativer Folgen fortsetzen. Für die Diagnose "Computerspielsucht" ("Gaming Disorder") muss der Betroffene jedoch mindestens ein Jahr lang Kriterien für ein computerspielbezogenes Suchtverhalten zeigen.
Übrigens verhängte Kagawa, eine japanische Präfektur, im April 2020 ein Zeitlimit für Videospiele bei unter 20-Jährigen, um Computer- bzw. Videospielsucht zu verhindern und die schulischen Leistungen junger Menschen zu verbessern. So wurden die Eltern dazu aufgefordert, die Spielzeit ihrer Kinder unter der Woche auf 60 Minuten und am Wochenende auf 90 Minuten pro Tag zu limitieren.
Zunahme von Konflikten in Partnerschaften und Trennungen
Während des "Corona-Shutdowns" mussten Paare und Familien viel Zeit auf engstem Raum verbringen, wodurch unterschwellige Spannungen und alte Schwierigkeiten reaktiviert werden und neue Konflikte ausbrechen können. So kommt es zu einem Anstieg von häuslicher Gewalt, ist es doch auch nicht mehr möglich, dem gewalttätigen Partner zu entkommen und zu Freunden oder Verwandten zu fliehen. Auch die Zahl der Scheidungen steigt durch die Coronakrise, denn Zuhause-bleiben-Müssen, Quarantäne, Homeoffice (oft mit gleichzeitiger Kinderbetreuung) oder plötzliche Arbeitslosigkeit waren bzw. sind ein echter Stresstest für eine Partnerschaft. Schließlich geht es in jeder Beziehung darum, dass zwei Menschen ein für sich passendes Gleichgewicht zwischen Verbundenheit und Autonomie finden. Beides sind menschliche Grundbedürfnisse: einerseits das Bedürfnis nach einem "Wir" bzw. nach Nähe mit dem anderen; gleichzeitig bleiben wir aber in jeder Beziehung auch ein "Ich" mit eigenen Bedürfnissen und eigenen Zielen; andererseits gibt es in uns also auch immer das Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit. Durch die erzwungene Nähe und viele Einschränkungen kann die Coronakrise für viele Paare die bislang mehr oder weniger erlebte Balance zwischen Verbundenheit und Autonomie in ihrer Beziehung völlig ins Ungleichgewicht bringen. Verbundenheit und Autonomie können in Beziehungen auf verschiedenen Ebenen erlebt werden. Durch Miteinander-Reden lässt sich etwa Nähe mit anderen erfahren. Vor allem Emotionen geben einem wortwörtlich das Gefühl, sich mit dem anderen verbunden zu fühlen, wie das Erleben von Liebe oder Vertrauen. Auch gemeinsame Zeit, die man miteinander verbringt, oder Ziele, die man miteinander verfolgt, lassen uns Zusammenhalt erfahren. Oder körperliche Nähe wie in der Sexualität schafft ein buchstäbliches Vereint-Sein. Und auch gemeinsame Werte können uns verbinden oder eher "trennen", wie politische oder religiöse Überzeugungen. Um in einer Beziehung möglichst zufrieden sein zu können, sollte man wissen, welche Art von Verbundenheit aber auch Autonomie bzw. wieviel man mindestens davon braucht, um zufrieden zu sein. Jedes Paar muss für sich die stimmige Balance zwischen Verbundenheit und Autonomie finden. Das Lebendige an Beziehungen ist, dass dieses Ausbalancieren zwischen zwei Individuen immer wieder neu gefunden werden muss. Schließlich scheint das einzige Unveränderliche im Leben die Veränderung zu sein.
Wer ist psychisch am stärksten belastet?
Menschen, die aus sozial oder ökonomisch benachteiligten Milieus kommen, spüren die psychische Belastung durch die Coronakrise am stärksten. Sie sind viel stärker von chronischen Krankheiten und damit auch Corona-Todesfällen, Jobverlust oder Langzeitarbeitslosigkeit betroffen und leiden häufiger als Personen aus höher gebildeten Schichten unter psychischen Erkrankungen wie Angststörungen, Depressionen oder Stresserkrankungen.
In den sogenannten Corona-Risikogruppen (wie die der älteren Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen) wirkt verständlicherweise die Furcht besonders tief, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Psychisch belastet sich hier auch Beschäftige des Gesundheitswesens und der Rettungsdienste vor allem in Ländern, die besonders von der Coronakrise betroffen waren oder sind: wie Italien, Spanien, USA oder Brasilien. So verweist etwa Devora Kestel, Expertin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), auf Berichte, wonach die Zahl der Suizide unter medizinischem Personal bereits zugenommen habe.
Auch Kinder und Jugendliche leiden in der Coronakrise stark unter mentalen Druck. So verzeichnet "Rat auf Draht" einen Anstieg der Anrufe um 30 Prozent (Vergleichszeitraum: April 2019); "Rat auf Draht"-Statistik im Detail:
- ANGST: Plus ↑ 220 %
- SCHLAFPROBLEME: Plus ↑ 240 %
- ANFRAGEN ZU PSYCHISCHEN ERKRANKUNGEN wie Panikattacken, Depressionen, Borderline: Plus ↑ 146 %
- SUIZIDGEDANKEN: Plus ↑ 54 %
- AUTOAGGRESSION: Plus ↑ 54 %
- PSYCHISCHE GEWALT IN DER FAMILIE: Plus ↑ 380 %
- PHYSISCHE GEWALT IN DER FAMILIE: Plus ↑ 88 %
- KONFLIKTE ZWISCHEN ELTERN, DIE KINDER BELASTEN: Plus ↑ 205 %
Alleinerzieherinnen und Mütter, die zugleich im Berufsleben stehen, sind psychisch – wie erwähnt – sehr belastet, was sich beispielsweise auch in einer Steigerung der Anrufe bei der Frauenhelpline um 50 bis 70 Prozent ausdrückt.
Auch für Menschen mit hohen Ansprüchen an sich selber oder Personen, die äußerst perfektionistisch veranlagt sind, wird der psychische Druck und der persönliche Stresspegel nun eher noch stärker erlebt.
Der Höhepunkt der psychischen Belastung in der Bevölkerung kann aus fachlicher Sich aber erst erwartet werden – wie bisherige Wirtschaftskrisen und Umweltkatastrophen zeigten, wenn das gewohnte Leben wieder in Gang kommt und die staatlichen Geldhilfen und gesellschaftlichen Unterstützungen verringert werden.
Die Coronakrise scheint für uns alle eine Herausforderung – sei es psychisch, sozial, gesellschaftlich oder ökonomisch. Menschen reagieren jedoch sehr unterschiedlich auf Krisen. In stürmischen Lebenszeiten scheinen einige Schutzwände zu bauen; andere versuchen eher Windmühlen zu konstruieren. Und manche Menschen verwandeln sich zu lebendigen Windkraftwerken, die im Sturm regelrecht zu tanzen beginnen!
- Was kann ich gegen den Corona-Stress tun?
- Warum Ärger, Wut und Zorn Menschen zum Protest auf die Straße bringen?
- Lebenskrisen, Verluste, Belastungen (psychisch oder sozial)
- Angststörungen, Phobien, Panikattacken
- Depressionen, Burnout, Erschöpfungszustände
- Umgang mit Stress, Stressbewältigung, Stressmanagement
Selbsthilfe für Zuhause
Anti-Depressions-Training
 Robert Riedl zeigt dir, wie du persönliche Fähigkeiten einsetzen kannst, um möglichst zuversichtlich und wohlwollend durchs Leben zu gehen.
Robert Riedl zeigt dir, wie du persönliche Fähigkeiten einsetzen kannst, um möglichst zuversichtlich und wohlwollend durchs Leben zu gehen.
Robert Riedl: Das Fortuna-Programm - Anti-Depressions-Training
Lösungsorientierte Therapie für Zuhause. Drei Zuversichtsübungen
Arbeitsbuch, 249 Seiten (broschiert)
24,99 €
Anti-Depressions-Training
 Robert Riedl gibt dir konkrete Anleitungen, wie individuelle Lösungswege gefunden und persönliche Probleme besser bewältigt werden können.
Robert Riedl gibt dir konkrete Anleitungen, wie individuelle Lösungswege gefunden und persönliche Probleme besser bewältigt werden können.
Robert Riedl: Das Morpheus-Programm - Anti-Depressions-Training
Drei Veränderungsübungen mit Notfallplan bei akuten Depressionen
Arbeitsbuch, 269 Seiten (broschiert)
24,99 €
Angst-Therapie-Kurs
 In Robert Riedls Arbeitsbuch wird dir ganz konkret und praktisch gezeigt, wie du dich deinen Ängsten gezielt stellen und den "Teufelskreislauf der Angst" bewusst unterbrechen kannst.
In Robert Riedls Arbeitsbuch wird dir ganz konkret und praktisch gezeigt, wie du dich deinen Ängsten gezielt stellen und den "Teufelskreislauf der Angst" bewusst unterbrechen kannst.
Robert Riedl: Das Kerberos-Programm - Angst-Therapie-Kurs
Eine Drei-Schritte-Anleitung
Arbeitsbuch, 219 Seiten (broschiert)
24,99 €